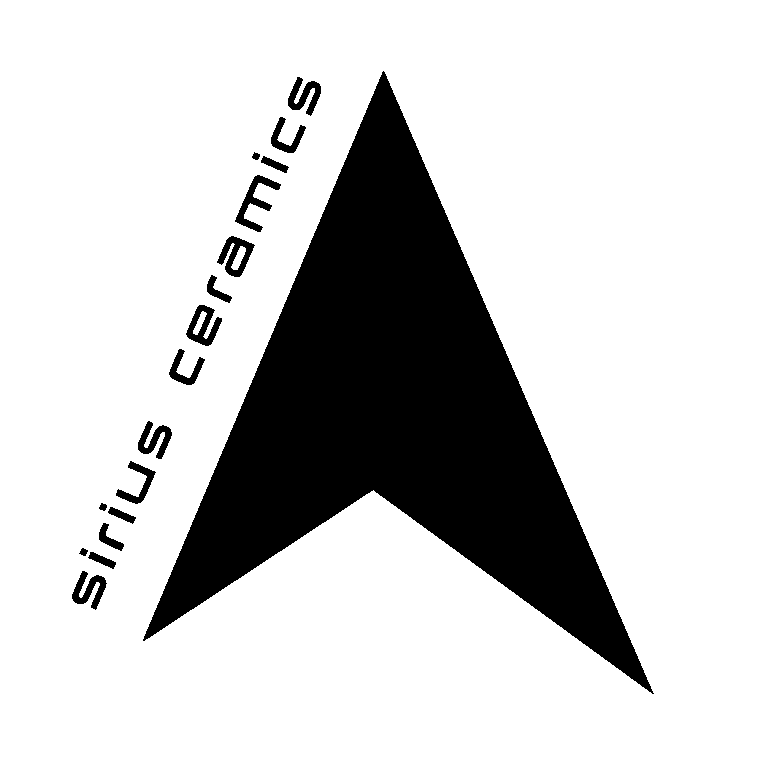DOPPELKRONEN-KONZEPT MIT KERAMISCHEN PRIMÄR- UND GALVANO-SEKUNDÄRTEILEN
Der Autor arbeitet in der Doppelkronen-Technik seit mehr als fünfzehn Jahren mit keramischen Halteelementen und gehört zu den Wegbereitern dieses Konzeptes. Die konischen Primärteile finden ihren Haltekraft über Feingoldmatrizen (Weigl-Protokoll). Dieser Artikel stellt ein Update 2015 dar. Es werden grundlegende Parameter in Erinnerung gerufen und dem Leser eine aktuelle Standortbestimmung gegeben. Anhand einer Musterdarstellung wird das „Ur“-Konzept mit seinen Besonderheiten figuriert und danach anhand eines Patientenfalles das zahntechnische Protokoll im Jahr 2015 dargestellt.